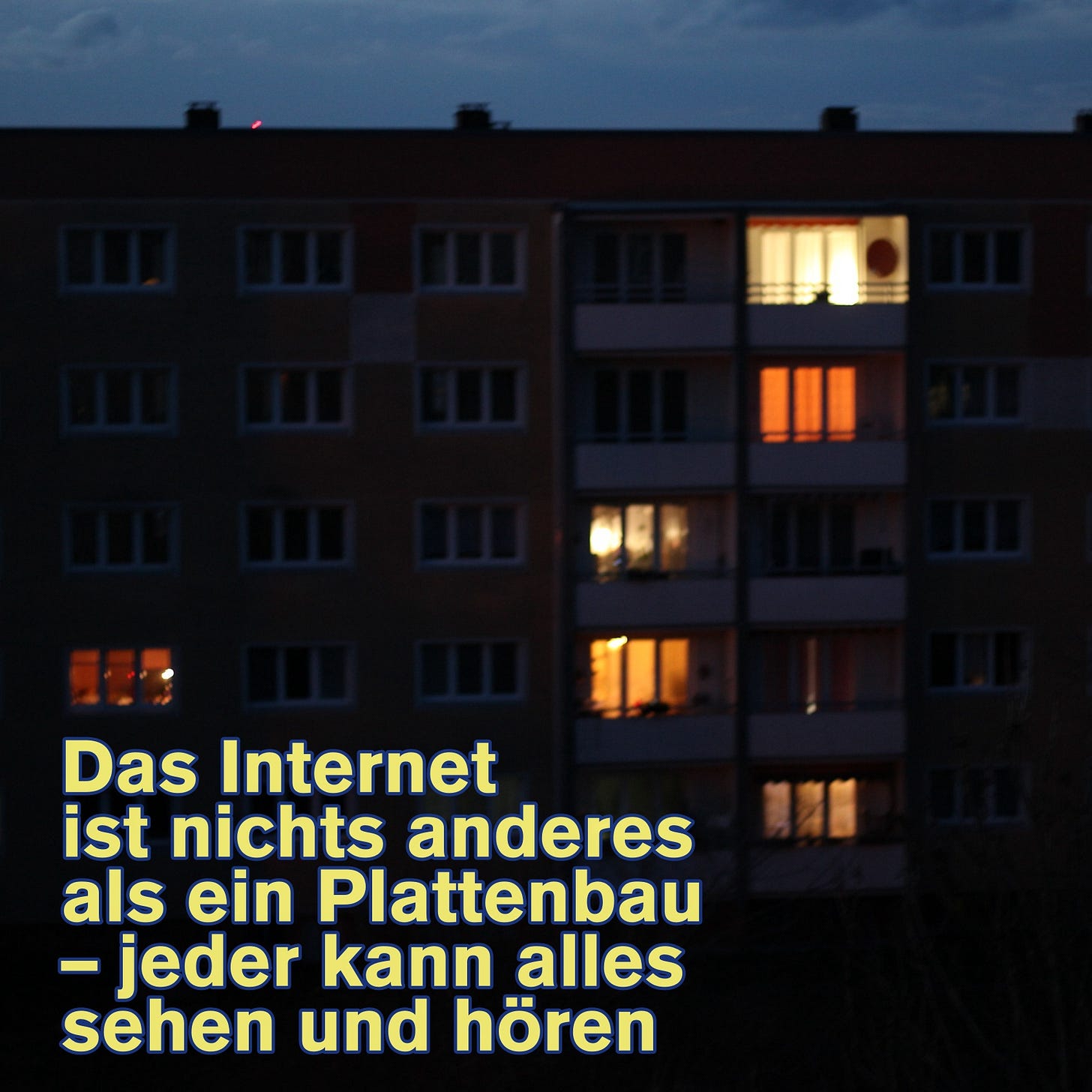Mikrokosmos Platte
Zwischen Ideal und Realität: Was die Platte über das Leben in Ostdeutschland erzählt.
Leipzig-Grünau, Halle-Neustadt, Lütten-Klein und Marzahn – Orte, die sofort Bilder hervorrufen. Von grauem Beton bis hin zur sozialistischen Idealstadt, die Perspektiven auf Plattenbaugebiete sind vielfältig. In der neuen ARD-Serie Marzahn, mon Amour (Regie: Clara Zoë My-Linh von Arnim), basierend auf dem Roman von Katja Oskamp, begegnen gängigen Klischees herzerwärmende Geschichten.
Die Serie zeigt, Plattenbauten sind mehr als bloßer Beton. Sie sind Nachbarschaft und Resonanzraum. Aber: Woher kommt die Platte eigentlich? Was können wir heute von der Wohnungspolitik der DDR lernen? Und wie inspiriert sie Künstler*innen in der Gegenwart?
Neubau und Neubeginn
Gleich zu Beginn: Platte ist eigentlich eine abwertende Bezeichnung für eine bestimmte Art von Wohnhäusern, hat sich aber inzwischen im Sprachgebrauch durchgesetzt. Neubau oder Großtafelbau wären präzisere Begriffe, um diesen Stil seriellen Bauens zu beschreiben. Dabei werden Gebäude aus vorgefertigten Betonelementen zusammengesetzt – eine Methode, die es ermöglicht, schnell und kostengünstig neuen Wohnraum zu schaffen. Und diese Bauweise ist keineswegs eine sozialistische Erfindung.
Die Geschichte der Platte reicht viel weiter zurück. Bereits im 19. Jahrhundert experimentierte Großbritannien mit vorgefertigten Häusern aus Holz- und Eisenkonstruktionen, um sich möglichst schnell in ihren Kolonien anzusiedeln.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts baute die Stadt Liverpool Arbeiterunterkünfte aus vorgefertigten Betonplatten. Kein Wunder, dass eine kostengünstige und schnelle Bauweise besonders für koloniale und kapitalistische Stadtentwicklungen attraktiv war. Auch für die durch den Zweiten Weltkrieg stark zerstörten deutschen Städte wurde das Verfahren interessant. Zunächst wurde in Ost und West daran gearbeitet, günstig und schnell Wohnraum zu schaffen. Doch besonders die DDR-Führung trieb die Entwicklung effektiver und kostengünstiger Typen seriellen Bauens mit staatlicher Förderung voran.
Das Recht auf angemessenen Wohnraum war in der DDR-Verfassung verankert. Das SED-Regime erklärte die Wohnungsfrage in den 70ern sogar zum Kern der Sozialpolitik. Nach eigenen Angaben baute die DDR bis 1990 so fast 2 Millionen Neubauwohnungen. Zwischen 80 Pfennigen und 1,25 DDR-Mark kostete der Quadratmeter Wohnfläche, denn die Regierung subventionierte den Mietpreis stark. Und dennoch, die Wohnungsfrage konnte in der DDR nie ganz gelöst werden. Bis zum Ende der DDR herrschte Wohnraummangel, die Wartezeit auf eine Wohnung betrug bis zu zehn Jahre.
Leben im Mikrokosmos
„Das Internet ist nichts anderes als ein Plattenbau – jeder kann alles sehen und hören“, sinniert eine Kundin des Nagelstudios in Marzahn, mon Amour. Hier arbeitet die Protagonistin der Serie Kathi, und begegnet so den Füßen und Geschichten der Bewohner*innen des Viertels. Auf herrlich direkte Art skizziert die Serie so den Mikrokosmos Plattenbaugebiet. Der Blick auf die diversen Geschichten der Bewohner*innen ist dabei durchweg liebevoll, ohne in Sozialromantik abzudriften. Schnittbilder – etwa vom sich ständig wandelnden Aushang des vietnamesischen Restaurants in der Siedlung von Sushi zu Bubble Tea oder von Jugendlichen, die TikTok Tänze üben – verweisen auf die kontinuierlichen Veränderungen im Kiez.
Das Neubaugebiet ist auch für den Soziologen Steffen Mau von Bedeutung, um die ostdeutsche Gesellschaft besser zu verstehen. In seinem Buch Lütten Klein – Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft beschreibt er anhand des gleichnamigen Neubaugebiets in Rostock, wie sich die Wende auf die soziale Struktur in Ostdeutschland auswirkte.
Er argumentiert, dass Neubausiedlungen wie Lütten Klein zu DDR Zeiten eine bestimmte Lebensweise versprachen: Neben Einkaufsmöglichkeiten und Kinderbetreuung sollte der Staat auch Kunst und Kultur bieten. Ein fester Anteil der Baukosten war beispielsweise für Kunst am Bau reserviert. Die Neubaugebiete waren attraktive Wohnorte, versprachen den Komfort von Zentralheizungen, Warmwasser und Badewannen. Auch die Bewohner*innen waren sozioökonomisch sehr verschieden: Der Professor wohnte neben der Werftarbeiterin oder der Kassiererin. Als Idealstädte waren sie wichtige Bausteine für den Sozialismus.
Besonders die soziale Komponente von Neubaugebieten finde ich spannend. Wie können heute Nachbarschaften entstehen, in denen Menschen unterschiedlichster Herkunft, Lebensmodelle und Einkommen selbstverständlich nebeneinander wohnen? Wie lässt sich Wohnraum gestalten, der nicht nur bezahlbar, sondern auch gemeinschaftsstiftend ist?
Plötzlich Problembezirk
Doch mit der Wende änderte sich auch das Image der Neubaugebiete. Viele anliegende Industrien schlossen, Bewohner*innen zogen in den Westen, es kam zur sozialen Entmischung. Viele Städte begannen mit dem Rückbau der Plattenbauten, um übermäßigen Leerstand zu vermeiden.
„Grauer Beton, rauer Jargon
Freiheit gewonnen, wieder zerronnen
Auf und davon, nicht noch eine Saison
Auf und davon, nicht noch eine Saison“
– jedes Mal, wenn ich an einem Plattenbau vorbeilaufe, habe ich Trettmanns Stimme im Ohr. Der Rapper beschreibt in dem Song Grauer Beton sein Aufwachsen im Fritz-Heckert-Neubaugebiet in Chemnitz und die verlorene Hoffnung, die ihm dort heute entgegenschlägt. War das Heckertgebiet zeitweilig das zweitgrößte Neubaugebiet der DDR, in dem fast 90.000 Menschen lebten, standen in den 90ern schnell die Hälfte der Wohnungen leer. Mit staatlicher Förderung wurden bis 2009 rund 11.000 Wohneinheiten abgerissen.
Comeback der Platte
Kam der Rückbau zu früh? Denn heute fehlen in Deutschland laut aktuellen Schätzungen rund eine halbe Million Wohnungen – besonders im bezahlbaren Segment. Die Bundesregierung will gegensteuern: 400.000 neue Wohnungen sollen pro Jahr entstehen. Ob das eine Rückkehr zum seriellen Bauen bedeutet, wird derzeit intensiv diskutiert.
Tatsächlich läuft die Weiterentwicklung serieller Bauweisen längst auf Hochtouren. In Thüringen entstehen klimaneutrale Plattenbauten, andernorts werden Einfamilienhäuser aus recycelten Betonelementen realisiert. Architekt*innen und Stadtplaner*innen experimentieren seit Jahren mit nachhaltigen, sozialen und ästhetisch überzeugenden Varianten des modularen Bauens. Die Platte wird dabei nicht einfach modern aufgelegt, sondern grundlegend neu gedacht.
Mon Amour, was nun?
Auch künstlerisch wird das Erbe der Platte viel reflektiert. Bereits vor zwanzig Jahren setzte sich die Künstlerin Dagmar Schmidt in ihrem Projekt Grabungsstädte mit der Vergangenheit und Zukunft des Neubaus auseinander. In Halle-Silberhöhe schuf sie einen begehbaren Betonabguss einer Plattenbauwohnung – nach Originalgrundriss und mit historischen Materialien. Seitdem dokumentiert sie, wie Besucher*innen mit dieser 432 Quadratmeter großen „Freilichtwohnung“ interagieren – und so das Verhältnis von Raum, Erinnerung und Zukunft ausloten.
Vielleicht liegt gerade in der Geschichte der Platte ein Zukunftsmodell: nicht als Wiederholung der Vergangenheit, sondern als Einladung, neue Antworten auf alte Fragen zu finden. Und vielleicht beginnt alles damit, Geschichten zu erzählen – so lebendig wie die von Kathi im Nagelstudio in Marzahn, mon Amour.
Bis Bald,
Frida
Wie lässt sich die Zukunft der Stadt gestalten?
Das diskutiert das Recht auf Stadt Forum, dieses Jahr in der Kulturhauptstadt Chemnitz. Die Teilnahme ist kostenlos.
Noch mehr Geschichten zum Plattenbau gefällig?
Die liefert das Buch Wohnen für Alle – Eine Kulturgeschichte des Plattenbaus von Robert Liebscher.
Wie blicken Künstler*innen heute auf die Platte?
Das zeigt das Festival Wohnkomplex in Halle-Neustadt – ein Archiv zeitgenössischer Perspektiven auf 60 Jahre Plattenbaugeschichte.